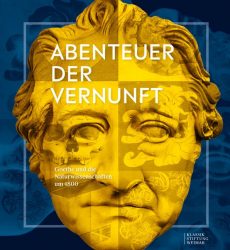Goethe ist das Muster dessen, was man als einen Universaldilettanten ansehen darf, und es ist in diesem Fall nicht einmal negativ gemeint. Goethe hatte seit früher Jugend ein ungewöhnlich breit gestreutes Interesse an nahezu allen Naturerscheinungen, betrieb Forschungen auf eigene Faust, ohne den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Entwicklung auf den entsprechenden Gebieten zu kennen oder für die Analyse seiner eigenen Neugier methodisch ausreichend gerüstet zu sein. Insbesondere seine lebenslange Antipathie gegen die mathematischen Fundamente der Naturwissenschaft stand ihm für einen wirklich erschöpfenden Zugang zu physikalischen Phänomenen immer im Weg.
Eigentlich habe ich aufgehört, populäre Bücher über Goethe zu lesen (was den Fliegenden Goethe-Blättern gar nicht bekommt!), denn man liest zu seiner und letztlich auch anderer Enttäuschung in diesen Büchern doch immer wieder dasselbe, also das, was der Autor irgendwo anders abgeschrieben hat, wo man es selbst auch schon gelesen hat. Und wenn einmal etwas Neues drin steht, ist es meistens falsch, und man ärgert sich.
Doch zwischendurch schleicht sich dann doch wieder ein Titel an mich heran, und ich werde neugierig. So auch bei Stefan Bollmanns „Warum ein Leben ohne Goethe sinnlos ist“. Guter Titel! Und Stefan Bollmann verdanke ich immerhin so hübsche Bücher wie „Frauen, die lesen, sind gefährlich“. Also nehme ich – provinziell wie ich wohne – den Service jenes großen Versenders mit dem Flussnamen in Anspruch, der mich in viele neue Bücher bequem hineinschauen lässt. Und nach nur wenigen 100 Zeilen finde ich folgendes:
»Man lebt nur einmal«, war einer seiner [Goethes] Lieblingssätze.
Da bin ich überrascht, denn obwohl ich mir einbilde, Goethes Werke einigermaßen zu kennen, konnte ich mich an gerade diese Phrase nun gar nicht erinnern. Also werfe ich die Suchmaschine an und finde:
Und fassen Sie wieder Fuß auf der Erde! Man lebt nur einmal.
Das ist aus einem Brief Goethes an jenen geheimnisvollen Johann Friedrich Krafft (vom 11. November 1778), in dem er den ihm persönlich Unbekannten, der sich verzweifelt an ihn um Hilfe gewendet hatte, nach Jena weist, wo er ihm weitere Hilfe zukommen lassen will. Er spricht dem an der Welt verzagenden Mann ein aufmunterndes Wort zu, sicherlich in dem Bewusstsein, dass man sich in solchen Lagen immer nur hilflos der Phrase bedienen kann, um so mehr, wenn man den Angesprochenen kaum kennt. Wer mehr über diese Geschichte erfahren möchte, kann das dritte Kapitel in Albrecht Schönes „Der Briefschreiber Goethe“ lesen, das genau diesem Brief gewidmet ist.
Aber der Satz kommt bei Goethe noch einmal vor:
Wunderlich! Mich dünkt doch, man lebt nur Einmal in der Welt, hat nur Einmal diese Kräfte, diese Aussichten, und wer sie nicht zum besten braucht, wer sich nicht so weit treibt als möglich, ist ein Tor. Und heiraten! heiraten just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll! sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen noch nicht gemacht hat! Daß du sie liebtest, das war natürlich, daß du ihr die Ehe versprachst, war eine Narrheit, und wenn du Wort gehalten hättest, wär’s gar Raserei gewesen.
Das sagt Carlos in „Clavigo“ (I, 1), als er dabei ist, Clavigo zu jener zynischen Haltung zu überreden, die schließlich Marie Beaumarchais das Leben kosten wird.
Einer seiner Lieblingssätze? Ja, wenn man’s nicht ein bisschen tiefer wüsste.
 W. Daniel Wilson gibt gern das Enfant terrible der Goethe-Forschung. Im Jahr 1999 gelang ihm mit „Das Goethe-Tabu“ der erste größere Erfolg in dieser Rolle, als er nachwies, dass es sich bei Goethe – einem Mann der immerhin ein knappes Jahrzehnt Minister und den Großteil seines Lebens Geheimer Rat in einem deutschen Kleinstaat gewesen war – nicht um das Vorbild eines liberalen Demokraten gehandelt hatte, sondern um einen ziemlich konservativen, staatserhaltenden und restriktiven politischen Kleingeist, der vor der Zensur freiheitlichen Gedankengutes auch nicht einen Augenblick zurückschreckte. Die meisten Goethe-Kenner gähnten angesichts dieser tiefen Einsicht, die ihnen schon vor etwa hundert Jahren einmal irgendwo über den Weg gelaufen war, aber immerhin ließ sich dadurch eine Ikone der akademischen Goethe-Verkennung wie Katharina Mommsen zu Dummheiten im Goethe-Jahrbuch hinreißen. In London poppten die Sektkorken! Weiterlesen auf Bonaventura …
W. Daniel Wilson gibt gern das Enfant terrible der Goethe-Forschung. Im Jahr 1999 gelang ihm mit „Das Goethe-Tabu“ der erste größere Erfolg in dieser Rolle, als er nachwies, dass es sich bei Goethe – einem Mann der immerhin ein knappes Jahrzehnt Minister und den Großteil seines Lebens Geheimer Rat in einem deutschen Kleinstaat gewesen war – nicht um das Vorbild eines liberalen Demokraten gehandelt hatte, sondern um einen ziemlich konservativen, staatserhaltenden und restriktiven politischen Kleingeist, der vor der Zensur freiheitlichen Gedankengutes auch nicht einen Augenblick zurückschreckte. Die meisten Goethe-Kenner gähnten angesichts dieser tiefen Einsicht, die ihnen schon vor etwa hundert Jahren einmal irgendwo über den Weg gelaufen war, aber immerhin ließ sich dadurch eine Ikone der akademischen Goethe-Verkennung wie Katharina Mommsen zu Dummheiten im Goethe-Jahrbuch hinreißen. In London poppten die Sektkorken! Weiterlesen auf Bonaventura …
 Albrecht Schöne, der das nicht kleine Kunststück fertiggebracht hat, mit einer Faust-Ausgabe zu Feuilleton-Bekanntheit zu gelangen, legt ein neues Goethe-Buch vor. Für Schöne bin ich meinem Vorsatz untreu geworden, keine Goethe-Literatur mehr zu lesen, denn wenn es sich nicht gerade um eine germanistische, hoch spezialisierte Monographie handelt, liest man zu mindestens 80 % das, was man in den 50 Büchern zuvor auch schon gelesen hatte. Schöne allerdings hält, was ich von ihm erwartet habe, denn selbst dort, wo sein Buch langweilig ist, ist es das auf originelle Weise.
Albrecht Schöne, der das nicht kleine Kunststück fertiggebracht hat, mit einer Faust-Ausgabe zu Feuilleton-Bekanntheit zu gelangen, legt ein neues Goethe-Buch vor. Für Schöne bin ich meinem Vorsatz untreu geworden, keine Goethe-Literatur mehr zu lesen, denn wenn es sich nicht gerade um eine germanistische, hoch spezialisierte Monographie handelt, liest man zu mindestens 80 % das, was man in den 50 Büchern zuvor auch schon gelesen hatte. Schöne allerdings hält, was ich von ihm erwartet habe, denn selbst dort, wo sein Buch langweilig ist, ist es das auf originelle Weise.
Schöne beschäftigt sich mit den Goetheschen Briefen mit einer extremen Pars-pro-toto-Methode: Er wählt aus den nahezu 15.000 bekannten Goethe-Briefen 9 (!) aus, zu denen er dann jeweils einen umfangreichen Kommentar liefert. Die ausgewählten Briefe umspannen das gesamte Leben Goethes: Es beginnt mit einem sehr formalen Aufnahmegesuch des pubertären Goethe in eine Gruppe adeliger Schöngeister und endet mit einem Brief an Wilhelm von Humboldt, den Goethe nur wenige Tage vor seinem Tod abgeschlossen hat. Weiterlesen auf Bonaventura …
 Bei Goethes »Wanderjahren« handelt es sich unbestreitbar um den schwierigsten Roman des Weimarer Meisters. Nicht nur die Editions- und Redaktionsgeschichte stellt eine Herausforderung für jeden Herausgeber dar, sondern die inhaltliche Breite und formale Beliebigkeit des Buches fordern auch ein hohes Maß an Toleranz von den Lesern. Für die konkrete Lektüre hilft es auch wenig, wenn uns versichert wird, bei dem Roman handele es sich um einen frühen Vorläufer der Moderne, wenn man von Seite zu Seite mehr geneigt ist, ausnahmsweise ein einziges Mal im Leben Friedrich Gundolf zuzustimmen und den Roman nicht nur stofflich, sondern auch technisch langweilig, d. h. verfehlt zu finden (»Goethe«, Berlin 101922, S. 716). Auch dass sich Goethe des höchst problematischen Charakters seines Buches offenbar bewusst war, hilft nur indirekt weiter; aber dazu später noch ein paar Worte.
Bei Goethes »Wanderjahren« handelt es sich unbestreitbar um den schwierigsten Roman des Weimarer Meisters. Nicht nur die Editions- und Redaktionsgeschichte stellt eine Herausforderung für jeden Herausgeber dar, sondern die inhaltliche Breite und formale Beliebigkeit des Buches fordern auch ein hohes Maß an Toleranz von den Lesern. Für die konkrete Lektüre hilft es auch wenig, wenn uns versichert wird, bei dem Roman handele es sich um einen frühen Vorläufer der Moderne, wenn man von Seite zu Seite mehr geneigt ist, ausnahmsweise ein einziges Mal im Leben Friedrich Gundolf zuzustimmen und den Roman nicht nur stofflich, sondern auch technisch langweilig, d. h. verfehlt zu finden (»Goethe«, Berlin 101922, S. 716). Auch dass sich Goethe des höchst problematischen Charakters seines Buches offenbar bewusst war, hilft nur indirekt weiter; aber dazu später noch ein paar Worte.
 Auf knapp 320 Seiten einen Überblick über das Werk Johann Wolfgang von Goethes zu geben, ist alles andere als eine einfache Aufgabe. So sollte jeder Versuch mit einer gewissen Milde betrachtet werden und eher darauf hin betrachtet werden, was gelungen ist, als was fehlt. Meier liefert eine grob chronologisch geordnete, thematisch gebündelte Einführung in Goethes Schreiben und Denken. Er konzentriert sich auf die wichtigsten, meist rezipierten Werke, fügt aber auch ein Kapitel über Goethes naturwissenschaftliche Versuche ein, bevor er sich am Ende ein wenig in der Begeisterung für den zweiten Teil des »Faust« verliert. Es wird nur ein rudimentäres biographisches Gerüst geliefert; biographische Details erfährt man nur dort, wo sie zum Verständnis eines einzelnen Werks notwendig erscheinen.
Auf knapp 320 Seiten einen Überblick über das Werk Johann Wolfgang von Goethes zu geben, ist alles andere als eine einfache Aufgabe. So sollte jeder Versuch mit einer gewissen Milde betrachtet werden und eher darauf hin betrachtet werden, was gelungen ist, als was fehlt. Meier liefert eine grob chronologisch geordnete, thematisch gebündelte Einführung in Goethes Schreiben und Denken. Er konzentriert sich auf die wichtigsten, meist rezipierten Werke, fügt aber auch ein Kapitel über Goethes naturwissenschaftliche Versuche ein, bevor er sich am Ende ein wenig in der Begeisterung für den zweiten Teil des »Faust« verliert. Es wird nur ein rudimentäres biographisches Gerüst geliefert; biographische Details erfährt man nur dort, wo sie zum Verständnis eines einzelnen Werks notwendig erscheinen.
Abgesehen von der Frage, ob man Meiers Deutungen und Gewichtungen zustimmt, macht das Buch einen soliden Eindruck und informiert seinen Leser über alle wichtigen Aspekte des Werks. Die historische Einordnung des Werks hätte ich mir detaillierter und kritischer gewünscht, es ist ihr aber prinzipiell nicht widersprechen. Eine durchaus anspruchsvolle Einführung, die aber nicht für sich allein stehen kann und weitere Lektüre notwendig macht.
Albert Meier: Goethe. Dichtung, Kunst, Natur. Stuttgart: Reclam, 2011. Pappband, 346 Seiten. 24,95 €.
 Kleines Heft aus der Reihe »Menschen und Orte«, die ich bislang noch nicht kannte. Bekanntlich erwarb Christoph Martin Wieland 1797 ein Landgut in Oßmannstedt in der Nähe Weimars, um sich, ohne rechten Erfolg, als Landwirt zu versuchen. Das Haus ist, nachdem es zuletzt als Schule gedient hatte, von der Stiftung Weimarer Klassik zu Anfang des 21. Jahrhunderts endlich renoviert und die ehemals winzige Gedenkstätte (zwei Räume) erweitert worden, um den Begründer des Weimarischen Musenhofs an dieser Stelle angemessen präsentieren zu können. Der Ort ist natürlich allein deshalb wichtig, weil Wieland dort zusammen mit seiner Frau Dorothea und der »Seelentochter« Sophie Brentano in einem der schönst gelegenen deutschen Dichtergräber liegt.
Kleines Heft aus der Reihe »Menschen und Orte«, die ich bislang noch nicht kannte. Bekanntlich erwarb Christoph Martin Wieland 1797 ein Landgut in Oßmannstedt in der Nähe Weimars, um sich, ohne rechten Erfolg, als Landwirt zu versuchen. Das Haus ist, nachdem es zuletzt als Schule gedient hatte, von der Stiftung Weimarer Klassik zu Anfang des 21. Jahrhunderts endlich renoviert und die ehemals winzige Gedenkstätte (zwei Räume) erweitert worden, um den Begründer des Weimarischen Musenhofs an dieser Stelle angemessen präsentieren zu können. Der Ort ist natürlich allein deshalb wichtig, weil Wieland dort zusammen mit seiner Frau Dorothea und der »Seelentochter« Sophie Brentano in einem der schönst gelegenen deutschen Dichtergräber liegt.
Das nur 32 Seiten starke Heft enthält zahlreiche Abbildungen und Fotographien, und in der sie begleitenden, kenntnisreichen Biographie lassen sich auch vom Kenner noch nette Funde machen:
Mit Sorge betrachtete er [Wieland] die zunehmende Schwäche Dorotheas. Vierzehn Kinder hatte sie ihm geboren. „Es wären noch mehr geworden, wenn sich die Eheleute nicht zeitlebens gesiezt hätten“, hatte Goethes Freundin Charlotte von Stein gespottet.
Christoph Martin Wieland in Oßmannstedt. Text: Bernd Erhard Fischer. Photographien: Angelika Fischer. Berlin: Ed. A·B·Fischer, 2008. 32 Seiten, geheftet. 7,80 €.
Nach Auffassung der Südwestpresse muss Goethe als Arzt praktiziert haben:
Die Patientenkartei Goethes ist lang.
Auf den zweiten Blick merkt man dann, dass dem Autor wohl der Unterschied zwischen einer Patientenakte bzw. einer Krankengeschichte und einer Patientenkartei nicht klar ist.
Aus der tiefsten provinziellen Ahnungslosigkeit berichtet der Schwarzwälder Bote:
Titisee-Neustadt (hil). Goethe hätte sicher auch seinen Spaß an der Bühnenfassung seines Gedichts „Der Hexenmeister“ gehabt, wie es als Kindertheater von Mika als Zauberermeister und Rino als Lehrling im Kursaal des Neustädter Hof über die Bühne ging. Auch, oder gerade weil dies in einer sehr, sehr freien Fassung geschah.
Hätte er sicherlich, wenn er denn ein solches Gedicht geschrieben hätte. Seines heißt aber bekanntlich „Der Zauberlehrling“.
Es wird Frühling und also Zeit für die schreibende Zunft, Ihre Unkenntnis des Goetheschen Fausts einmal mehr unter Beweis zu stellen. Da schreibt ein „sr“ im Hallensischen Super Sonntag:
„Solch ein Gewimmel möcht ich sehn“ hatte einst der große Goethe seinen Faust im Osterspaziergang sagen lassen.
Nicht ganz. Zwar kommt das Wort Gewimmel tatsächlich im Osterspaziergang vor:
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Aber die zitierte Zeile stammt aus Faustens Todesszene im zweiten Teil der Tragödie:
Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Äonen untergehn. –
Aber sonst stimmt’s.
Copyright © 2024 by: Fliegende Goethe-Blätter • Design by: BlogPimp / Appelt Mediendesign • Lizenz: Creative Commons BY-NC-SA.